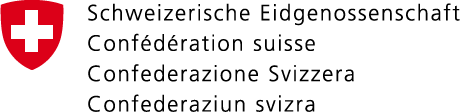Eine neue Ära der Gerechtigkeit: Simbabwe verabschiedet sich von der Todesstrafe
Im Dezember 2024 vollzog Simbabwe einen historischen Schritt, indem es die Todesstrafe abschaffte und damit sein Engagement für die Menschenrechte bekräftigte. Dieser Meilenstein wurde durch jahrelange politische Arbeit erreicht, wobei die Schweiz – über ihre Botschaft in Harare – eine Schlüsselrolle bei der Steuerung der Diskussionen und der Förderung des Dialogs spielte.

In öffentlichen Konsultationen in den Provinzen Mashonaland in Simbabwe wurde über die Abschaffung der Todesstrafe informiert. Die öffentlichen Konsultationen waren eine Initiative der Schweizer Botschaft, des Centre for Applied Legal Research und der Regierung von Simbabwe. © Botschaft der Schweiz in Harare, 2023.
Am 21. Dezember 2024 unterzeichnete Simbabwe ein Gesetz zur Abschaffung der Todesstrafe – ein Meilenstein für die Menschenrechte. Diese Entscheidung verspricht, das Justizsystem des Landes neu zu gestalten und sein Engagement für Würde und Menschenrechte zu untermauern.
Diese historische Reform war das Ergebnis einer unermüdlichen Zusammenarbeit zwischen simbabwischen Regierungsbeamten, der lokalen Zivilgesellschaft und einer Vielzahl internationaler Partner, wobei die Schweiz über ihre Botschaft in Harare hinter den Kulissen eine entscheidende, diskrete Rolle spielte. Der Prozess begann mit einer umfassenden Prüfung der Interessengruppen, bei der ein Netzwerk von Akteuren und Organisationen aufgedeckt wurde, die auf Reformen drängten, und gleichzeitig die dringende Notwendigkeit eines stärkeren Engagements der Regierung deutlich wurde.
Dialog mit verschiedenen Teilen der Gesellschaft
In diesem Sinne bemühte sich die Schweizer Botschaft in Zusammenarbeit mit dem Centre for Applied Legal Research (CALR) um die Überbrückung von Differenzen, indem sie gezielte Treffen mit wichtigen Ministerien organisierte – insbesondere mit dem Ministerium für Justiz, Recht und Parlamentsangelegenheiten (MoJLPA). Ihre Bemühungen trugen dazu bei, Unterstützung aus verschiedenen Teilen der Gesellschaft zu mobilisieren und legten den Grundstein für hochrangige Konsultationen, die von der Schweiz unterstützt wurden und Regierungsvertreter, die Zivilgesellschaft, religiöse Führer und internationale Expertinnen und Experten an einen Tisch brachten.
Durch Konsultationen direkt vor Ort in den zehn Provinzen Simbabwes wurde die Forderung nach Veränderung weiter unterstrichen. Die einfachen Bürgerinnen und Bürger Simbabwes, von denen viele zuvor kaum mit Debatten über die Todesstrafe in Berührung gekommen waren, machten sich die Sache schnell zu eigen, da sie die Auswirkungen auf die Menschenrechte und die soziale Gerechtigkeit verstanden.
«Simbabwes entscheidender Schritt in Richtung Gerechtigkeit markiert nicht nur eine Reform unseres Rechtssystems, sondern auch ein Wiedererwachen unseres nationalen Gewissens», bemerkte ein lokaler Anwalt – ein Eindruck, den auch die simbabwische Generalstaatsanwältin, Frau Virginia Mabhiza, in einem kürzlich erschienenen Artikel teilte, in dem sie die Entscheidung als einen Moment der Veränderung für das Land bezeichnete.
Während des gesamten Prozesses spielten Sensibilisierungstreffen eine wesentliche Rolle. Diese Sitzungen waren von entscheidender Bedeutung, um die Parlamentsmitglieder über die menschlichen Kosten der Todesstrafe aufzuklären und sicherzustellen, dass die Unterstützung durch die Legislative sowohl informiert als auch unterstützend war.
Als Stimmen aus allen Teilen der Gesellschaft zur Unterstützung der Abschaffung zusammenkamen, wurde das neue Gesetz zu einem Hoffnungsschimmer – ein Versprechen, dass die künftige Justiz mit Transparenz, Rechenschaftspflicht und Respekt für jedes menschliche Leben ausgeübt werden würde.
Fachliche und strategische Beratung der Schweiz
Der Beitrag der Schweiz war zwar subtil, aber seine Wirkung war unbestreitbar. Die Botschaft in Harare leistete wichtige fachliche Unterstützung und strategische Beratung, die dazu beitrug, bewährte internationale Verfahren an den einzigartigen Kontext Simbabwes anzupassen. Ihre Unterstützung, zusammen mit der von CALR, war ausschlaggebend dafür, dass politische Bestrebungen in eine konkrete, zukunftsorientierte Reform umgesetzt wurden, die Simbabwe nun zu den Nationen zählt, die sich für ein menschlicheres Justizsystem einsetzen.
Für viele Menschen in Simbabwe ist dies nicht nur ein juristischer Sieg, sondern eine tiefgreifende Bestätigung ihres Rechts auf ein Leben in Würde. Während die Nation dieses neue Kapitel aufschlägt, dient der Geist der Zusammenarbeit, der die Abschaffung der Todesstrafe vorangetrieben hat, als Vorbild für künftige Menschenrechtsinitiativen – ein Beweis dafür, was erreicht werden kann, wenn sich die Führung der Regierung, die Zivilgesellschaft und internationale Partner gemeinsam für Gerechtigkeit einsetzen.
Einsatz des EDA zur Abschaffung der Todesstrafe
Die Schweiz hat sich in ihrer Aussenpolitischen Strategie 2024–2027 das Ziel gesetzt, die weltweite Abschaffung der Todesstrafe aktiv voranzutreiben. Sie lehnt die Todesstrafe entschieden ab, da sie im Widerspruch zum Grundrecht auf Leben und zur Menschenwürde steht. Das EDA richtet seine Aktivitäten deshalb darauf aus, diesem Grundsatz mehr Anerkennung zu verschaffen und die Unvereinbarkeit der Todesstrafe mit der Achtung der Menschenrechte zu unterstreichen. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt das EDA verschiedene Instrumente in ihrer Aussenpolitik ein:
- Diplomatische Arbeit: Sie führt Gespräche mit Staaten, die die Todesstrafe noch anwenden, und ermutigt sie, diese abzuschaffen oder zumindest deren Anwendung einzuschränken und auszusetzen.
- Stärkung internationaler Normen: Die Schweiz engagiert sich für ein stärkeres internationales Regelwerk zur Einschränkung der Todesstrafe, unter anderem durch eine führende Rolle in UNO-Initiativen und durch die Unterstützung regionaler Institutionen.
- Internationale Zusammenarbeit: Gemeinsam mit gleichgesinnten Staaten und zivilgesellschaftlichen Organisationen arbeitet sie an konkreten Fortschritten zur Abschaffung der Todesstrafe.
Die Koordination dieser Aktivitäten liegt bei der Abteilung Frieden und Menschenrechte (AFM) im Staatssekretariat des EDA. Die AFM hat den Überblick über multilaterale und bilaterale Massnahmen und verfügt über ein Budget zur Unterstützung von Projekten, die sich gegen die Todesstrafe einsetzen. Die Schweizer Auslandvertretungen beobachten ihrerseits die Situation in den Staaten, die die Todesstrafe noch nicht abgeschafft haben. Sie führen unter Berücksichtigung der lokalen Realitäten mit den Behörden und der Zivilgesellschaft einen Dialog zur Todesstrafe und unterstützen diese – wie im Beispiel Simbabwes – bei der Umsetzung von Massnahmen.
Weltweite Abschaffung der Todesstrafe – Aktionsplan 2024–2027