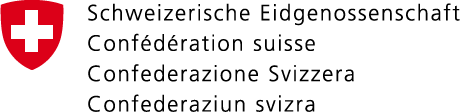Covid-19: Was bleibt?
Geprägt von einem hohen Tempo, einer sich dauernd verändernden Datenlage und dem Bedürfnis nach mehr Zeit für die persönliche Reflexion: In seinem Gastbeitrag schaut Bundesrat Ignazio Cassis in der NZZ zurück auf ein aussergewöhnliches Jahr. Wer entscheidet, wie viel ein Menschenleben Wert ist? Welche Bedeutung haben offene Grenzen? Und was bleibt, wenn wir irgendwann wieder zur Normalität zurückkehren? Eine persönliche Retrospektive.

Was bleibt nach einem Jahr Covid-19? Welche Folgen hat die Pandemie für die Gesundheit, aber auch für Wirtschaft und Gesellschaft? In einer sehr persönlichen Retrospektive schaut Bundesrat Ignazio Cassis zurück auf eine intensive und aufwühlende Zeit. © Keystone
Ich erinnere mich an dieses eine Bild. Die Luftaufnahme einer Baustelle. Tausende von Menschen, Kräne, Bagger – ein Ameisenhaufen. Eine Aufnahme im Zeitraffer. Und gleichzeitig das Standbild einer ganzen Generation. Covid-19 in einem einzigen Bild festzuhalten – fast unmöglich. Und doch hat sich in meinem Gedächtnis ein Bild festgesetzt, das für mich wie kein anderes Zeitzeugnis den Anfang dieser Krise illustriert: der Spitalbau in Wuhan.
In einer Zeit, in der das neue Virus noch eine abstrakte Atemwegserkrankung und vor allem ein Problem von anderen war, realisierten die chinesischen Behörden ein Bauprojekt, dessen Tragweite für uns in Europa kaum in Zahlen zu fassen war. Ein Bauvorhaben im Bereich der öffentlichen Gesundheitsversorgung dauert hierzulande gerne einmal 30 Jahre – auch ohne Einsprachen. In Asien werden innert weniger Stunden Wirtschaftsmetropolen abgeriegelt, 30 Millionen Menschen unter Quarantäne gestellt und Neubauten aus dem Boden gestampft. Ich erinnere mich an meine Faszination beim Anblick dieser Aufnahmen. Eine rein technische Faszination, versteht sich.

Hilfe! Hilfe! Ein Wolf!
Kurz darauf wird aus akademischem Interesse emotionale Betroffenheit. Am 25. Februar meldet Dr. med. Pietro Antonini aus der Clinica Moncucco in Lugano den ersten Covid-Fall der Schweiz. Im Tessin. In meiner Stadt. Jahre zuvor habe ich als Kantonsarzt während Sars und der Vogelgrippe die Vorbereitung zu Bekämpfung einer Epidemie mitgestaltet. Die Schweiz war vorbereitet. Allerdings hat der Mensch zwei Tugenden: Er vergisst schnell und er tut sich schwer, Verantwortung zu übernehmen. Es besteht immer die Gefahr, zu früh Alarm zu schlagen.
Wenn man vorschnell Massnahmen ergreift und die Epidemie kaum Folgen zeigt, kommt der Vorwurf, man habe überreagiert. Wenn man zu wenig unternimmt, erheben sich die kritischen Stimmen derer, die einem vorwerfen zu schlafen. Wer mitten in der kollektiven Ungewissheit Entscheidungen trifft, hat wenig zu gewinnen und viel zu verlieren. Entsprechend braucht der Transfer vom reinen Nachdenken hin zum konkreten Handeln nicht nur Zeit, die einem eine Krise per Definition selten zugesteht, sondern auch Mut – Mut, Alarm zu schlagen, ohne bereits alle Fakten zu kennen.
Tun wir das Richtige?
In der Ungewissheit der dürftigen Faktenlage helfen vordefinierte Prozesse. Für den Bundesrat hiess das: Ruhe bewahren und genau das tun, was in den Pandemieplänen steht. Und genau wie wir in den Plänen geschrieben hatten, brach in der Gesellschaft zuerst Unruhe aus. Die Menschen sorgten sich um etwas, was wir sonst gerne als selbstverständlich erachten: unsere Gesundheit. Ich erinnere mich gut an diese ersten Tage. Die fast stündlich wechselnde Fakten- und Gefühlslage – auch im Bundesrat. Eine Flughöhe schwankend zwischen Weltraummission und fünf Meter vor dem Crash, zwischen nationaler Gesundheitssicherung und lokalem Ladensortiment.
Es war absurd. Ein Wettkampf ohne Aufwärmphase. Und vor allem ein Wettkampf, an dessen Start wir nicht wussten, ob wir einen Sprint absolvieren oder einen Marathon laufen würden. Die Schweiz plötzlich per Notrecht zu führen und mit einer Vollmacht zu agieren war eine neue und kaum fassbare Erfahrung. Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg war in der Schweiz ein Krisenmanagement per Notrecht nötig. Noch nie wurde so viel Geld zur Bewältigung einer Krise gesprochen. Die Folgen waren schlaflose Nächte und die quälende Frage: Tun wir das Richtige?

Zeit und Distanz werden Klarheit bringen
Während wir in den Geschichtsbüchern lernen, im Notfall Frauen und Kinder zu retten, konzentrieren wir uns auf ältere und chronisch kranken Menschen. Ist das richtig? Ist das falsch? Wer bestimmt den finanziellen Wert eines Lebens? Im Notrecht entscheidet der Bundesrat. Eine kaum greifbare Verantwortung, die zu tragen eine Reflexion erfordert, für die es sich zwingend Zeit zu nehmen gilt – auch in einer Krise. Aber das Tempo ist zu hoch, um sich grundlegenden ethischen und gesellschaftsphilosophischen Fragen zu widmen. Ein fehlender Diskurs mit Konfliktpotenzial.
Der Bundesrat ist bereit, 40 Milliarden Franken zur Verfügung zu stellen – das entspricht 40 Prozent der Bruttoschulden der Schweiz. So massiv Geld auszugeben, das einem nicht gehört, und damit Schulden für die nächsten Generationen zu verursachen, bringt einen Generationenkonflikt zum Vorschein, der so unangenehm ist, dass kaum jemand darüber sprechen will. Erst die Retrospektive wird zeigen, ob wir richtig gehandelt haben.
Wirtschaft als Feind der Gesundheit
Als Gesellschaft fehlt uns im Moment die Zeit, uns solchen philosophischen Fragen zu stellen, und vor allem fehlt uns die Distanz. Aus Angst, auf die falsche Seite gestellt zu werden, schweigen wir lieber. Wer für die Gesundheit ist, ist gegen die Wirtschaft, wer die Wirtschaft retten will, opfert Menschenleben: Ein oberflächliches Schwarz-Weiss-Denken, als Ergebnis unseres Wohlstandes. Arme Länder mussten sich diesem Diskurs gar nicht stellen, weil sie es sich finanziell gar nicht leisten konnten. In vielen Ländern sind weder Gesundheit noch Wohlstand eine Selbstverständlichkeit, in vielen Kulturen gehört der Tod zum Leben dazu – die Vergänglichkeit des Seins ist hier Teil der gesellschaftlichen Diskussion.
In der Schweiz blieb uns diese Diskussion lange erspart. Nur, der Wohlstand der Schweiz basiert auf ihrer wirtschaftlichen Stärke. Wer Gesundheit und Wirtschaft zu Gegensätzen macht, ignoriert die Tatsache, dass das Einkommen der entscheidende Faktor für den Gesundheitszustand eines Volkes ist. Wirtschaft und Gesundheit sind zwei Seiten derselben Medaille. Der Gegensatz ist künstlich. Der Konflikt nutzlos und schädlich. Damit eine Gesellschaft bestehen kann, braucht sie gesunde Menschen, Arbeit und Geld. Prosperität ist nicht der Gegner der Gesundheit, sondern ihre Basis.

Grenzen schliessen! Leben retten!
Die Frustration über unser moralisierendes Denken und Handeln ist etwas, was mich seit einem Jahr nicht mehr loslässt. Es ist ermüdend und es entbehrt jeder Realität. Als ob eine Krise nach dem Schema Richtig-Falsch zu bewältigen wäre. Wenn uns die Pandemie eines gezeigt hat, dann dies: Agiles Vorgehen nach dem Versuch-Irrtum-Prinzip führt zwar nicht zur perfekten Lösung, ist aber allemal besser als eine zentralistische Doktrin, welche den einen Grundpfeiler unseres Wohlstandes gegen den anderen ausspielt. Auch die Schweiz ist keine von Gott gesegnete Insel der Wohlstandsgarantie.
Wir verdanken unsere Prosperität und unser fortschrittliches Gesundheitswesen in erster Linie unserer leistungsfähigen Wirtschaft, nicht zuletzt unserer starken Exportwirtschaft. Gerade in einer Phase der Globalisierungskrise, in der Landesgrenzen wieder wichtiger werden, wird nun zusätzlich der Ruf nach einer Schliessung laut – aus Abgrenzung wird Abschottung. Covid-19 hat unsere ambivalente Beziehung zur Landesidentität in den Vordergrund gerückt und Themen der gesellschaftlichen Entwicklung der letzten Jahre auf das politische und mediale Tapet gebracht.
Grenzregionen als Lebens- und Wirtschaftsraum
Die Diskussionen zur Schliessung der Grenzen waren von Beginn weg obsolet. Die Pandemie war bereits auf dem Weg zu uns, ein Aufhalten an der Landesgrenze mehr angstbasiertes Wunschdenken als realitätskonformes Krisenmanagement. Die Debatte hat uns aber vor Augen geführt, wie sehr wir die Grenzregionen als Lebensräume unterschätzen. Grenzen sind nicht nur identitätsstiftende Abgrenzung, sondern auch Verbindungslinie zwischen Ländern und Kulturen sowie Wirtschafts- und Lebensraum von tausenden von Menschen. So blieben beispielsweise das Tessiner und das Genfer Gesundheitssystem auch dank den italienischen und den französischen Grenzgängern funktionsfähig.
Und auch in Konstanz und Kreuzlingen war die Symbolkraft dieser Verbindungslinie augenfällig: Die emotionale Betroffenheit und der kollektive Protest, den der kurzzeitig errichtete Grenzzaun auslöste, unterstreichen, wie sehr die Bilder der gesellschaftlichen Historie Europas in unserem kollektiven Gedächtnis verankert sind. Wir leben, lieben und arbeiten nicht trotz der Grenzen in diesen Regionen, sondern wegen und mit ihnen. Eine komplette Schliessung der Schweiz stand dann auch nie zur Debatte. Wir haben zwar in der Terminologie der Grenzschliessungen gesprochen, faktisch waren die Grenzen aber für Güter immer und für Menschen partiell offen.

Kantonale Souveränität im kollektiven Bewusstsein
Als Bürger eines Grenzkantons ist die Bedeutung dieser Verbindungslinie tief in meinem Inneren verankert. Die Einzigartigkeit dieses kulturellen Guts wurde mir gerade während der Pandemie auf meinen wöchentlichen Reisen nach Bern immer wieder in Erinnerung gerufen. Wir haben im Tessin eine Dramaturgie erlebt, die am Südeingang des Gotthardtunnels aufhörte. Ich fuhr durch den Tunnel, und die Pandemie schien in dessen Dunkeln verschollen. Für mich hat die Pandemie die geografische und kulturelle Komponente der Schweiz hervorgehoben – im Guten wie im Schlechten. Die Tatsache, dass das europäische Epizentrum der Pandemie in Mailand war und das Tessin viel früher und viel stärker betroffen war, schaffte eine ganz andere Wahrnehmung.
Die Pandemie hat eindrücklich gezeigt, wie unterschiedlich die Schweiz tickt. Sie hat unsere Unterschiede, aber auch unsere kollektive Verbundenheit in unserer kantonalen Souveränität sichtbar gemacht. Föderalismus ist kein Schlagwort der Geschichte, sondern Abbild einer kulturellen und geografischen Realität. Bis heute gestaltet sich die Reise des Föderalismus als steter Balanceakt – ein bisschen mehr Bund, ein bisschen mehr Kantone.
Den Sommer nicht vor dem Frühling loben
Macht macht süchtig, auf jeder Stufe. Der Föderalismus ist das Antidot. Er zwingt zu Demut, Toleranz und dazu, Andersdenkende zu ertragen. Gerade das anstrengende Aushandeln, die endlosen Diskussionen und die klare Abgrenzung der Verantwortlichkeiten sind Basis unseres nationalen Zusammenhaltes. Doch Föderalismus braucht Gemeinsinn, gerade in Krisenzeiten. Eine Tugend, die in letzter Zeit etwas im Lärm der Massnahmengrabenkämpfe untergingen. Während wir uns im letzten Frühjahr noch mit kollektiver Verbundenheit gegen das übermenschliche Virus stemmten, wird der Ton je länger, desto rauer. Die einen wollen schärfere Massnahmen, die anderen die ersehnten Lockerungen. Statt einander zuzuhören, wird laut geschrien. Statt aufeinander zuzugehen, suchen wir die Konfrontation.
Dabei tun wir gerade jetzt gut daran, uns auf unsere föderalistischen Werte zu besinnen. Denn Durchhalten lohnt sich. Die steigende Testkapazität, das Contact-Tracing und die Impfstoffe leuchten als Hoffnungsschimmer hell am Horizont. Wir müssen aber bereit sein, den eingeschlagenen Weg gemeinsam konsequent weiterzugehen. In dem Moment, in dem der Optimismus zu spriessen beginnt wie die ersten Blumen auf der Frühlingswiese, droht uns mit der dritten Welle ein erneuter Wintereinbruch. Es liegt an uns, uns von dieser weissen Decke nicht erdrücken zu lassen. Es liegt an uns, gemeinsam für die ersehnte Freiheit zu kämpfen.
Dieser Gastbeitrag ist erschienen in der NZZ am 6. April 2021.