Seite nicht gefunden
Die von Ihnen aufgerufene Seite kann leider nicht angezeigt werden. Wahrscheinlich finden Sie die gesuchten Informationen in einer der unten aufgeführten Rubriken.
Die von Ihnen aufgerufene Seite kann leider nicht angezeigt werden. Wahrscheinlich finden Sie die gesuchten Informationen in einer der unten aufgeführten Rubriken.
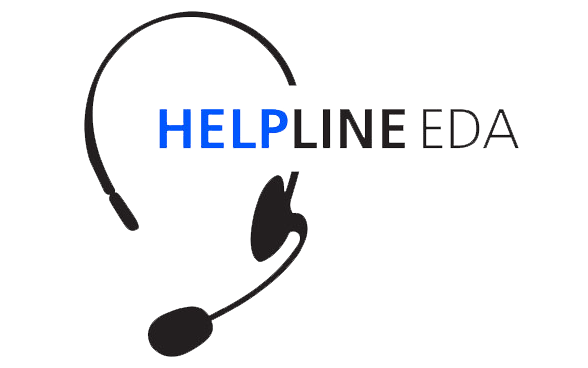
+41 800 24-7-365 / +41 58 465 33 33
365 Tage im Jahr – rund um die Uhr
Die Helpline EDA beantwortet als zentrale Anlaufstelle Fragen zu konsularischen Dienstleistungen.
Fax +41 58 462 78 66
.