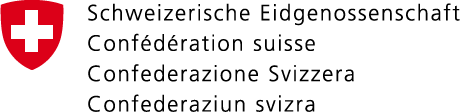Hintergrund
Bis ins Jahr 2050 werden rund 9 Milliarden Menschen die Erde bevölkern. Gleichzeitig verringern sich Ackerland, Weideflächen und Wasserressourcen. Agrarsysteme, welche die Weltbevölkerung mit ausreichend und nährstoffreicher Nahrung versorgen sind notwendig.
Während in Europa Nahrungsmittelverluste meistens am Ende der Kette entstehen, z.B. in Supermärkten, Restaurants oder zu Hause bei Konsumentinnen und Konsumenten, treten sie in Entwicklungsländern früher auf. Gründe dafür sind neben fehlendem Marktzugang unzureichende Ernte-, Verarbeitungs- und Lagerungsmethoden. Die Studie «Global Food Losses and Food Waste» aus dem Jahr 2011 der FAO zeigte, dass die Länder in Subsahara-Afrika dadurch pro Kopf jährlich bis zu 170kg an Nahrungsmitteln verlieren. Dies hat sich bis heute nicht grundlegend geändert.
Gemäss dem Internationalen Fond für landwirtschaftliche Entwicklung („International Fund for Agricultural Development“ IFAD), gibt es weltweit rund 500 Millionen Kleinbäuerinnen und Kleinbauern – kleinbäuerliche Landwirtschaft ist die Lebensgrundlage von über 2 Milliarden Menschen. Diese Familienbetriebe produzieren rund die Hälfte der Nahrungsmittel weltweit und mehr als 70 Prozent der Nahrungsmittel, die in Asien und in Afrika südlich der Sahara konsumiert werden.
Der Klimawandel, Naturkatastrophen und wirtschaftliche Veränderungen erschweren die Arbeit von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern. Sie müssen ihre Produktion den sich ändernden und kaum voraussehbaren Bedingungen anpassen. Deshalb sind sie auf Forschungs- und Beratungsdienstleistungen angewiesen. Für die DEZA sind solche Dienstleistungen erfolgreich, wenn sie traditionelles und lokales Wissen berücksichtigen. Die Schweizer Landwirtschaft mit ihrer multifunktionalen, auf sozialen und regionalen Ausgleich bedachten, familienbasierten und umweltschonenden Nahrungsmittelproduktion sind dabei Vorbild.