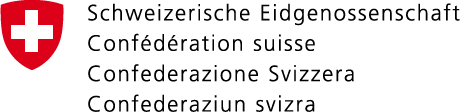Die unter dem Titel Schengen bekannte Zusammenarbeit europäischer Staaten in den Bereichen Grenze, Justiz, Polizei und Visa wurde 1985 von fünf Mitgliedstaaten der damaligen Europäischen Gemeinschaft lanciert. Sie umfasst heute fast alle EU-Mitgliedstaaten sowie die vier assoziierten Staaten Island, Liechtenstein, Norwegen und, seit dem 12. Dezember 2008, die Schweiz.
Europakarten zum Schengen und Dublin Abkommen
Das Schengen-Assoziierungsabkommen (SAA) erleichtert den Reiseverkehr zwischen der Schweiz und den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) durch die grundsätzliche Aufhebung von Personenkontrollen an den Binnengrenzen. Zudem verbessert es die internationale Justiz- und Polizeizusammenarbeit im Kampf gegen Kriminalität.
Mit dem SAA rechtlich verbunden ist das Dubliner Assoziierungsabkommen. Es stellt sicher, dass ein Asylgesuch nur von einem Staat im Dublin-Raum geprüft wird. Die Dublin-Kriterien legen die nationale Zuständigkeit fest und verhindern so, dass Asylsuchende in mehr als einem Staat ein Gesuch stellen können.